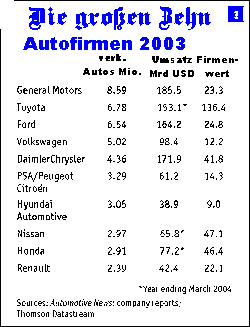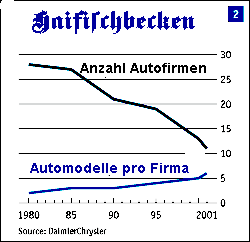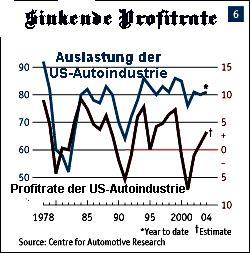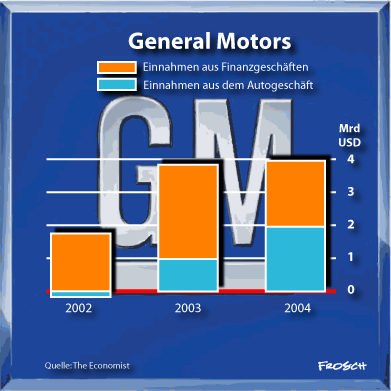|
Globale Krise der
Autoindustrie
Die Autoindustrie war über das ganze 20. Jahrhundert in den großen kapitalistischen Ländern Motor und Rückgrat des Kapitalismus und noch immer beeindruckt dieser Industriezweig: Hunderttausende Lohnarbeiter in aller Welt bauen jedes Jahr 60 Millionen Fahrzeuge – als Wertsumme entspricht das rund 10 Prozent des Bruttosozialprodukts der reichen kapitalistischen Länder. In ihrer Arbeit werden 15 Prozent der weltweiten Jahresstahlproduktion, 25 Prozent einer Jahresglasproduktion und 50 Prozent einer Jahresgummiproduktion produktiv konsumiert. Die gut 10.000 Einzelteile, aus denen die Lohnarbeiter die Autos konstruieren und zusammenbauen, machen rund 60% der Herstellungskosten aus. Von einem erfolgreichen Automodell werden weltweit rund 300.000 Stück verkauft. In der Nutzung aller Fahrzeuge wird jedes Jahr fast die Hälfte der weltweiten Ölproduktion verbraucht.
Im Jahr 1900 kostete ein – damals in handwerklicher Arbeit als Einzelstück gefertigter - Wagen 1000 Dollar – für damalige Verhältnisse ein Luxusgegenstand für wenige Reiche. Die Inflation herausgerechnet und in realen Preisen kostet heute ein Mittelklassewagen die Hälfte des damaligen Preises und wurde zu einem Produkt, das zur Bewältigung des Alltags in Arbeit und Erholung nötig ist. Durchschnittlich kauft im Laufe seines (Arbeits)Lebens jeder von uns sechs Autos. Für die meisten Menschen in den kapitalistischen Metropolen sind Autos die größte Anschaffung, für die sie sich langfristig verschulden müssen.
Man sollte also meinen, dass die Autofirmen mächtig Kasse machen.
Vergleiche Grafik 1:
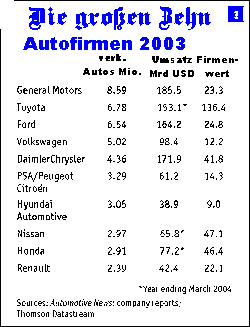
Von diesen Firmen
vereinen die größten sechs Firmen: General Motors, Toyota, Ford,
Renault/Nissan, VW und DaimlerChrysler über 70% aller Fahrzeugverkäufe in
der Welt.
US-Automarkt
In Europa und Amerika werden 80% der weltweit produzierten Fahrzeuge verkauft. Größter Einzelmarkt sind die USA. Im „Speckgürtel“ der USA, den wohlhabenden Vorstädten, ist eine Dreier-Garage nicht mehr ungewöhnlich.
Vergleiche Grafik 3:

1960 beherrschte General Motors mit 60% Marktanteil den US-Markt. Seitdem schickten immer mehr europäische und japanische Firmen ihre preiswerteren Autos auf den US-Markt. Die amerikanischen Kapitalisten bremsten mit Regierungshilfe diese lästige Warenkonkurrenz und verstärkten nur den Anreiz zum Kapitalimport. In den letzten 20 Jahren wurden in den USA 17 Autofabriken von ausländischen Unternehmen eröffnet, alle produktiver und profitabler als die traditionellen US-Firmen. Chrysler durchlief schon zweimal ein Bankrottverfahren, Ford stand mehrmals, General Motors einmal (1992) knapp vor dem Bankrott.
Auf dem amerikanischen Automarkt ist wie in Europa nur noch Wachstum des einen Kapitals auf Kosten eines anderen Kapitals möglich. Trotzdem steigerten alle Autofirmen alljährlich ihre weltweite Produktionskapazität um rund 3%, während die Nachfrage um höchstens 1% wächst. Die Autofirmen häufen nicht nur einen ständig wachsenden Überschuss an Fahrzeugen an, sie häufen gleichzeitig einen Überschuss an Produktionskapazität, einen Überschuss an Kapital an – Kapital, das weniger Profit abwirft als der Durchschnitt, ja sogar Kapital, das keinen Profit mehr abwirft – mindestens nicht in der Autobranche.
Die Autofirmen wurden immer größer, die Zahl ihrer Lohnarbeiter nahm global zu, aber noch schneller wuchsen ihre Kosten für Energie, Rohstoffe und Anlagen, das „konstantes Kapital“, so dass die Profite im Vergleich zum eingesetzten Kapital fielen: „Die Durchschnittsprofite der Autoindustrie sind weltweit von 20% oder mehr in den 20er Jahren des vorigen Jahrhunderts gefallen auf rund 10% in den 60er Jahren bis auf weniger als 5% heute.“ (Economist, 04.09.04)
Inzwischen machen einige Autofirmen keinen Profit
mehr, sondern zehren von ihrem Kapital.
Der Motor
des globalen Kapitalismus stottert
Ende der 20er Jahre des letzten Jahrhunderts gab es in den USA noch rund 270 Autohersteller. Sie wurden von den „Großen Drei“ – General Motors, Ford, Chrysler – vernichtet oder geschluckt. Weltweit gab es 1980 noch knapp 30 große Autofirmen, heute sind davon nur noch 10 übriggeblieben, wenn auch ein Teil der geschluckten Firmen noch als „Label“ oder Automarke scheinbar fortexistieren.
Siehe Grafik 2:
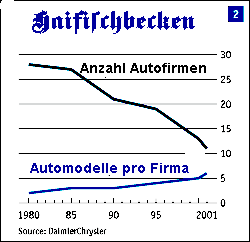
Früher konnten Firmen wie VW, Ford oder General Motors in guten Zeiten soviel Profit anhäufen, dass sie einzelne Krisenjahre überstanden. Die jetzige Krise der Autobranche ist jedoch eine chronische, keine saisonale Krise.
Die letzten drei Jahre konnten hohe Verkaufszahlen auf dem US-Markt nur durch kräftige Preisnachlässe gehalten werden. Die US-Hersteller gaben Preisnachlässe von rund 3000 Dollar pro Wagen, ihre europäischen und japanischen Konkurrenten von rund 1500 Dollar pro Wagen. Es wurde zwar mit 80% noch eine relativ hohe Kapazitätsauslastung erreicht und die Umsätze gehalten, aber die Profite fielen zwangsläufig in den Keller.
Siehe Grafik 6:
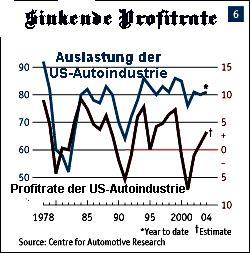
Nur wenige Autofirmen machen noch gute Profite, die meisten halten sich gerade so über Wasser, einigen steht das Wasser längst über dem Kopf.
Siehe Grafik 8:

Von den 17 aufgeführten Firmen liegt nur die Hälfte über der Profitabilitätsgrenze. Chrysler verlor im Jahr 2003 an jedem verkauften Wagen in den USA ganze 496 Dollar, Ford verlor pro Wagen 48 Dollar. General Motors machte gerade mal 178 Dollar Profit an jedem verkauften Fahrzeug. Der Profit von Honda dagegen belief sich auf 1.488 Dollar pro verkauftem Fahrzeug, Toyota machte an jedem Auto 1.742 Dollar Profit, Nissan sogar 2.402 Dollar.
Als künstliche Geldzufuhr bleiben für die Minus-Unternehmen nur wachsende Verschuldung über Bond-Anleihen. Ford und GM kurbeln weiter verlustreiche Auto-Verkäufe an, um mit den Ratenzahlungen der Käuferkredite Zinsen für ihre Gläubiger aufbringen zu können. Das ist eine höchst risikoreiche Überlebensstrategie, die, je länger sie dauert, um so sicherer zum Milliardengrab wird.
Selbst wo Autofirmen noch schwarze Zahlen in ihrer Bilanz ausweisen, ist das oft nur möglich durch „großzügige“ Bilanzierung und durch Finanzgeschäfte, die aus einer Autofirma mit angeschlossener Bank eine hochspekulative Bank mit angeschlossenem Autowerk werden lässt.
Siehe Grafik 9:
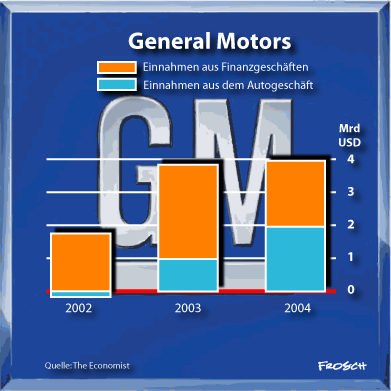
Eine einfach gestrickte Kapitalismuskritik meint, das „Finanzkapital“ sei eine eigene, dominierende Branche im Kapitalismus (linke Variante) oder gar ein personell und ethnisch eingrenzbarer Personenkreis (rechte Variante). Tatsächlich „schwitzt“ die Profitproduktion immer und überall überschüssiges Kapital aus, das sich auf Spekulation wirft – erst recht, wenn in klassischen Anlagensphären die Profitraten dahinschmelzen.
Natürlich werden in der Autobranche immer noch Gewinne gemacht. Aber sie fließen durch andere Kanäle als früher und landen nicht immer in den Taschen der großen Hersteller.
Vergleiche Grafik 4:

Es gibt in der Autobranche eine ähnliche Entwicklung wie auf dem Heimdrucker- oder Handymarkt: Man kauft einen (Gebraucht)Wagen zu einem geringen Einstandspreis und bezahlt während des Gebrauchs an überhöhten Unterhaltskosten, was man beim Einkauf gespart zu haben glaubt.
Nur 24 Prozent des jährlichen Gesamtprofits der
Autoindustrie fließen über den Autoverkauf in die Taschen der
Herstellerfirmen, 43 Prozent des Branchen-Profits wird über Ersatzteile
und Reparatur erwirtschaftet.
Wo ist
Rettung in Sicht?
Einige erhoffen sich von China die Rettung. Alle großen Autokapitalisten investieren heftig auf dem angeblich „unerschöpflichen“ chinesischen Markt. Neben den internationalen Autoherstellern existieren in China aber noch mehr als 100 einheimische Firmen.
Der Marktanteil von VW ist dort inzwischen trotz steigender Verkaufszahlen von 50% auf 30% gefallen. Im Jahr 2004 übertrafen alle Autoverkäufe in China mit 5 Millionen verkauften Fahrzeugen erstmals den deutschen Markt.
Dennoch machen die Verkäufe in China nur ein 12. der weltweiten Verkäufe aus. Sie können kurzzeitig einigen Autofirmen „neue Luft“ verschaffen, längerfristig wird sich in China nur das wiederholen, was schon in Brasilien und Argentinien vorgemacht wurde: ein scheinbar „unerschöpflicher“ Markt wird erschlossen, das Kapital fließt in Strömen dorthin und binnen weniger Jahre herrschen dort ebenso Überproduktion und Überkapazitäten wie in Europa und den USA.
Manche setzen ihre Hoffnung auf „Innovation“, auf neue Produktideen, die die Autoindustrie aus der Krise führen sollen.
Siehe Grafik 7:

Bei den „neuen Produkten“ handelt es sich aber um vergleichsweise winzige Stückzahlen. Man rechnet damit, dass Autos mit alternativem Treibstoff über die nächsten Jahre bis zu 10% Marktanteile erreichen.
Was mehr ins Gewicht fällt: Das jetzt und heute in die Autoindustrie investierte Kapital muss sich rentieren. Mit diesem Kapital müssen Profite erwirtschaftet werden. Neue Produkte würden aber neue Investitionen erfordern, deren Rentabilität zweifelhaft ist. Wo soll dieses Kapital herkommen, wenn das heute investierte Kapital kaum Profite abwirft, ja sogar zu seiner bloßen Erhaltung und Fortführung immer mehr Schulden (zusätzliches Kapital) nötig macht?
Eine letzte Hoffnung der Autokapitalisten liegt in weiterer Beschleunigung der Umschlagszeit ihres Kapitals: Zwar wurde die reine Produktionszeit, in der ein Auto hergestellt wird, auf unter 20 Stunden gesenkt, aber dann „parkt“ die produzierte Ware und wartet 40 bis 80 Tage auf einen Käufer. In dieser Zeit ist das Kapital in Warenform gefesselt und kann sich nicht vermehren – ganz im Gegenteil, Naturkräfte und modische Käuferwünsche zehren am Wert der Ware.
Würde die Wartezeit, bis die Ware Auto sich wieder in Geld und Kapital verwandelt, deutlich verkürzt, dann könnte zusätzliches Kapital freigesetzt und das in der Autoproduktion eingesetzte Kapital sich besser verwerten.
Aber
alle solche Maßnahmen: Entwicklung neuer Produkte, Erschließung neuer
Märkte, Beschleunigung der Produktions- und der Verkaufszeit wurden alle
schon in der Vergangenheit angewandt, und sie konnten den Fall der
Profitraten nur aufhalten oder verzögern, aber nicht ihre
Entwicklungsrichtung umkehren.
Und die
Gewerkschaften?
Scheinbar sind die Autofirmen die letzten großen Bastionen der Gewerkschaftsbewegung. Die IG Metall rühmt sich, dass bei VW Wolfsburg von 100 Lohnarbeitern 97 gewerkschaftlich organisiert sind. Sogar ein Herr Peter Hartz ist dort Mitglied der IG Metall.
Die in der deutschen Gewerkschaftsbewegung Aktiven hatten einen gesamtgesellschaftlichen Anspruch, solange sie glauben konnten, der Kapitalismus oder die „Soziale Marktwirtschaft“ schaffe Wohlstand für alle.
Selbst wenn man die Interessen der Lohnarbeiter sehr eng auslegt, waren jedoch die Gewerkschaftler nur in der „Schönwetterperiode“ des deutschen Kapitalismus zwischen 1955 und 1975 erfolgreich. In jeder wirtschaftlichen und politischen Krise, angefangen im ersten Weltkrieg, über die große Wirtschaftskrise von 1929 zur Machtergreifung Hitlers bis zur politischen und wirtschaftlichen Weichenstellung in der Bundesrepublik, einschließlich der Eingliederung der DDR – bei all diesen und anderen Gelegenheiten haben die Gewerkschaftler kläglich versagt.
Von dem traditionell-gesamtgesellschaftlichen Anspruch der Gewerkschaften ist heute nichts mehr geblieben. Sie haben sich selber mehr und mehr in der Gesellschaft isoliert.
Der Kampf für ein selbstbestimmtes Leben in einer selbstverwalteten Wirtschaft und Gesellschaft ist keine Lohngruppen- und keine Gehaltsfrage. Die Beseitigung der Lohnarbeit ist keine Frage des Geschlechts oder der Staatszugehörigkeit. Je radikaler eine Gewerkschaftsbewegung dem Kapitalismus an die Wurzel geht, desto zahlenmäßig mehr werden ihre Ansprechpartner und möglichen Mitakteure.
Die deutschen Gewerkschaftler gingen genau den umgekehrten Weg:
Weder konnten sie mit höherqualifizierten (angestellten) Lohnarbeitern viel anfangen, noch mit den aus der Arbeit verdrängten Arbeitslosen. Sie ergänzten das wirtschaftliche und gesellschaftliche Aussortieren von Kommunisten und „Linksradikalen“ aus Betrieben und Gesellschaft, die Ausgrenzung von Immigrantinnen und Immigranten, von chronisch Kranken, Behinderten und Alten noch dadurch, dass sie diese Leute auch noch aus der Gewerkschaftsbewegung faktisch oder rechtlich ausschloss.
Was von der alten Gewerkschaftsbewegung übrig blieb, sind betriebliche Lohnarbeitsvereine. Noch leisten sich diese betriebsegoistischen Arbeitervereine eine branchenweite gewerkschaftliche Dachorganisation. Wozu eigentlich dieser „Luxus“, wenn weniger als die Hälfte der westdeutschen und nur ein Viertel der ostdeutschen Betriebe noch an einen Flächentarifvertrag gebunden sind?
Wozu eigentlich dieser „Luxus“ einer Branchenorganisation, wenn man die Gewerkschaft nur noch als betriebliches „Versicherungsunternehmen“ ansieht, das allein den Interessen der zahlenden Mitglieder im eigenen Unternehmen dient?
Unsere betriebsegoistischen Gewerkschaftler sind so auf den Hund gekommen, dass vor kurzem die Betriebsratsfürsten großer Autofirmen den streikenden Kollegen in Ostdeutschland in den Rücken fielen und ihren Kampf für Arbeitszeitverkürzung erst sabotierten und dann stoppten, weil durch den Streik in Zulieferbetrieben die Autoproduktion in „ihrem“ Unternehmen gefährdet wurde.
Die Gewerkschaftler bleiben Papiertiger, wenn sie sich bei jeder Frage in Angestellte und Arbeiter, Ausländer und Deutsche, Qualifizierte und Unqualifizierte, Beschäftigte und Unbeschäftigte, Radikale und Gemäßigte aufspalten lässt. Die Gewerkschaftler werden zu kastrierten Katern, wenn sie sich nur noch um ihre betriebliche Interessen scheren.
Das haben in diesem Jahr die Kollegen von Siemens ebenso zu spüren bekommen wie die Lohnarbeiter von DaimlerChrysler. In beiden Unternehmen ist die Betriebs-Gewerkschaft kläglich eingeknickt. Bei Opel Rüsselsheim und anderswo geht es um den „Standort“. Bei VW wollen die Kapitalisten die Lohnkosten in den nächsten sieben Jahren um 30 Prozent senken – pro Jahr eine durchschnittliche Lohnsenkung von 4,3 Prozent.
Nicht nur die Autokapitalisten stecken in einer Krise, sondern auch alle Gewerkschaftler, die meinen, man könne das „Wohl der Lohnarbeiter“ am besten fördern, wenn man das Wohl der „eigenen“ Kapitalisten fördert.
Quellen
The price of age. The Economist 23.12.2000
Extinction of the car giants. The Economist, 14.06.03
Price wars and profit woes. The Economist 02.08.03
Shape up or ship out. The Economist, 11.10.03
Cadillac comeback. The Economist, 24.01.04
The curse of Pischetsrieder. The Economist 28.02.04
The three Fs. The Economist 06.03.04.
Face value: Two Hartz beat as one. The Economist 04.09.04
Survey: The car industry. The Economist 04.09.04.
Wal Buchenberg für Indymedia, 7. September 04.
|